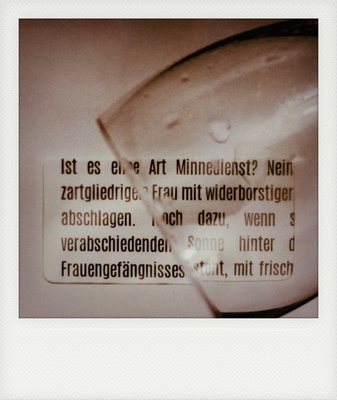Neue Ziegeleimanufaktur Glindow - Eine Zeitreise -

Wie bei so vielem in Kunst und Leben kommt es darauf an, was Fleiß und Geschick aus dem Rohmaterial machen. Das Beste kann unvollkommen entwickelt, das Schwächste zu einer Art Vollkommenheit gehoben werden. So auch beim Ziegelbrennen. [...] Aber was ihnen ihre Vorzüglichkeit leiht, ist nicht das Material, sondern die Sorglichkeit, die Kunst, mit der sie hergestellt werden. Jedem einzelnen Stein wird eine gewisse Liebe zugewandt. Das macht’s.
Theodor Fontane, Wanderungen durch die Mark Brandenburg
Wer das Alter erreicht hat, dass er den Fall der Mauer bewußt erlebte und nach der »Wende« vor den in West-Berlin einfallenden freiheits- und konsumtrunkenen DDR-Bürgern für einen kurzen Ausflug in den »Osten« floh, fühlt sich auf dem Gelände der Ziegelei Glindow an diese Grenzüberschreitungen erinnert. Die Zeit scheint hier stehen geblieben zu sein. Weit mehr als ein Vierteljahrhundert lang.
Betritt man das Ziegeleigelände, sieht man vor sich einen großen geduckt wirkenden Ringofen, dessen gemauerte, schwarz-braune Außenhaut regelmäßig durchbrochen wird von halbrunden, ovalen Öffnungen, die wirken wie verschlossene Eingänge zur Unterwelt. Über dem gewaltigen Ziegelrund thront - getragen von einer leicht und luftig wirkenden Holzkonstruktion - das nur wenig über den Ofen ragende flache, mit schwarzen Ziegeln gedeckte Dach. Seitlich neben dem Ofen steht ein fast fünfzig Meter hoher Kamin, der vermutlich sofort zusammenbrechen würde, wenn man ihm eines seiner flachen Stahlbänder raubte, mit denen er gegürtet ist wie ein dicker alter Riese.
Die Anlage hat nichts von der fast klinischen Sterilität heutiger Industrieansiedlungen. Der Charme des Maroden ist an jeder Ecke unübersehbar. Gräser, Moose, Sträucher und Bäume wuchern von keiner gärtnerischen Anstrengung behelligt. Überall steigen Inseln aus mehr oder weniger altem Industrieschrott auf und die mit Produktionsresten von gebrannten und glasierten Ziegeln beladenen Paletten scheinen um diese Inseln zu treiben wie steuerlose Flösse. Die Gebäude stehen da als stolze Ignoranten der Gezeiten kontemporärer Architektur.
Im ganzen westlichen Havelland, dem Kernland der Mark Brandenburg, stößt man auf Ortsbezeichungen, die die Silbe »Glin« oder »Glien« im Namen führen. Der Begriff kommt aus dem Slawischen und heißt so viel wie »Ort, an dem es Lehm gibt«. Die Namensgebung von Dörfern, Städten, Brücken und gar Schlössern deutet auf die vielfältige Nutzung des Wortes »Glien« hin und ist ein Hinweis auf die Wertschätzung des einzigen veredelbaren »Rohstoffes« des Landes Brandenburg.
Das Brennen von Ziegeln als Baumaterial hat eine lange Tradition, sind doch Lehmziegel der älteste von Menschen geschaffene Baustoff. Im Berliner Pergamonmuseum ist ein herausragendes frühes Beispiel für die kunstvolle Ziegeleiarchitektur Mesopotamiens zu sehen. Dort wurde vor mehr als 2.500 Jahren das Ischtar-Tor aus farbig glasierten Ziegeln als ein Teil der Stadtmauer Babylons erbaut.
In Brandenburg mit einer eher landwirtschaftlich geprägten Infrastruktur trifft man eine gewerbliche Produktion von Ziegeln und anderen Gütern erst mit dem Mittelalter an. Ab dem 18. Jahrhundert siedeln sich vornehmlich in den Städten Manufakturbetriebe an, erste merkantile Beziehungen werden geknüpft. Von der Bildung gewerblich-frühindustrieller Strukturen kann bis dahin allerdings noch keine Rede sein. Erst mit dem schnellen Fortschreiten der industriellen Entwicklung Berlins, das bis 1900 zum größten deutschen Industriestandort wird, setzt auch für die Mark Brandenburg eine bisher nicht gekannte Entwicklung ein. Zum einen siedeln sich Industriebetriebe in der Mark an, zum anderen findet aus Brandenburg eine erheblich Randwanderung von Arbeitern in die Metropole Berlin statt. Infolge der Bevölkerungsverdichtung in Berlin steigt dort die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, deren schneller Austausch durch den forcierten Ausbau der Verkehrsverbindungen auf Wasser, Schiene und Straße zwischen der Mark und dem Zentrum Berlin ermöglicht wird. Der Ausbau der Infrastruktur stellt also eine wichtige Voraussetzung für die industrielle Entwicklung auch Brandenburgs dar. Für die Industrialisierung der Mark Brandenburg spielt ebenso die Entwicklung der heimischen Baustoffindustrie eine erhebliche Rolle. Etwa ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert steigt der Bedarf in Berlin an Ziegeln, Kalk, Mörtel, Gips, Glas und anderen Produkten, die für den Bau von Wohnungen und Gewerbegebäuden, exorbitant an. Es bilden sich in der Mark regionale Zentren gewerblich-industrieller Produktion heraus, die meist mit spezialisierten Produkten Berlin beliefern. Dachziegel kommen aus Rathenau, gelber Klinker aus Birkenwerder, Gips aus Sperenberg, Fensterglas aus Baruth, Ziegel aus Zehdenik und eben aus Glindow.
Die Glindower Ringöfen sind die zwei einzigen, original erhaltenen Ziegelöfen ihrer Art in Europa. Zu verdanken sind sie dem Erfindungsreichtum von Friedrich Eduard Hoffmann (1818–1900), der 1858 den sogenannten Hoffmannschen Ringofen zum Patent anmeldete.
Die Idee des Berliner Baumeisters Hoffmann war einfach und genial: Er ordnete eine Reihe von Brennkammern im Kreis an. Durch diese ließ er das Feuer hindurchwandern. War der Brennvorgang in einer Kammer abgeschlossen, wurde die nächste mit Brennstoff beschickt. Durch Luftkanäle erwärmten die gerade gebrannten Ziegel die Zuluft für das Feuer, trockneten und wärmten die noch ungebrannten Rohlinge vor. Gegenüber den beheizten Kammern befanden sich die jeweils kühlsten Kammern. Hier konnten die fertigen Ziegel entnommen und neue Rohlinge aufgefüllt werden. Das Feuer benötigte ein bis zwei Wochen, um die zehn bis 16 Kammern zu durchwandern.
Der Ofen, an dem in der Folge noch einige Verbesserungen vorgenommen wurden und dessen Form zum Oval abgewandelt wurde, revolutionierte die Ziegelherstellung grundlegend. In weniger als 15 Jahren erbaute Hoffmann, der für circa 30 Staaten das Patent darauf hatte, mit seinem ziegeltechnischen Planungsbüro um die 1.000 Ringöfen.
Das Hoffmannsche Prinzip der Ziegelherstellung hielt sich fast ein Jahrhundert. Erst ab Mitte der 1950er Jahre wurden die Ringöfen durch Tunnelöfen abgelöst, in denen nicht mehr das Feuer, sondern das Brenngut wandert.
Mitte des 19. Jahrhunderts begann die hohe Zeit der Ziegelproduktion in der Mark Brandenburg und Glindow gehörte neben Rathenow und Zehdenick zu den bedeutendsten Ziegeleistandorten in der Region. Was allerdings heute - einem Romantisierungsbedürfnis folgend - unseren Blick verklärt, darf nicht über die unsäglich schweren Lebens- und Arbeitsbedingungen für die Ziegler der damaligen Zeit hinwegtäuschen. Die soziale Stellung der vielfach als saisonale Wanderarbeiter tätigen Ziegler befand sich auf gleicher oder niedrigerer Stufe mit denen von landschaftlichem Gesinde oder Tagelöhnern. Die Arbeitsbedingungen kann man schlicht als miserabel bezeichnen. 16 Arbeitsstunden waren Mitte des 19. Jahrhunderts keine Seltenheit, die Temperatur an den Ringöfen betrug 50° bis 70° Celsius, die ausströmenden Rauchgase waren extrem gesundheitsgefährdend und die körperliche Belastung trotz zunehmender Mechanisierung exorbitant. Kinder- und Frauenarbeit war - insbesondere in saisonalen Spitzenzeiten - an der Tagesordnung. Bis auf die Bezahlung für qualifizierte Arbeitskräfte - Brenner, Setzer, Sümpfer, Streicher - reichte das Einkommen kaum für das Allernotwendigste. Untergebracht waren viele der Ziegler in Zieglerkasernen. Eine aus dem Jahr 1889 stammende polizeiliche Ordnung aus dem Kreis Templin sah für die Unterkunft einer Person mindestens 2 Quadratmeter Grundfläche und 7,6 Kubikmeter Luftraum vor. Das dürfte heute kaum für die amtlichen Bestimmungen zur Unterbringung kleinerer Haustiere ausreichend sein. Auch Metropolen wachsen eben nicht auf dem Rücken der durch die Geschichtsschreibung heroisierten Gestalten.
Werfen wir einen näheren Blick auf einen der beiden, circa 50 Meter im Durchmesser messenden Ringofen. Der Ringofen lässt sich auch von Besuchern betreten. Die Brennkammern mit ihren teilweise zugemauerten, mannshohen Öffnungen sind umgeben von einem Rundgang, der nur spärlich beleuchtet wird von einfallendem Sonnenlicht und zitterigen elektrischen Funzeln. In den geöffneten Kammern stapeln sich gebrannte Ziegel auf fahrbaren Metallgestellen zum Abkühlen. Die Luft hier ist stickig und heiß.
Plausibler wird die Funktionsweise des Ringofens, wenn man auf die runde Decke der Brennkammern steigt. Man erreicht sie über eine hölzerne Brücke, die aussieht wie der Zugang zu einer mittelalterlichen Burg. Trotz der offenen Bauweise des Daches wirkt der riesige Raum düster. Kreisrund sind hier Behälter angeordnet, die mit Kohlenstaub gefüllt sind und wie von einem nicht sichtbaren Dirigenten angehalten werden, ein atonales kakophonisches Konzert zu geben. Es ist das Surren von kleinen Motoren, das Rasseln von Ketten und das Ächzen von Metall, bei dem sich die Behälter nach unten öffnen und den Flammen dosiert Kohlenstaub zugeführt wird. In der Mitte des Daches befindet sich ein rechteckiger Verschlag, aus dem gelbliches Licht dringt. Hier muss der Dirigent sitzen. Aber der Verschlag ist verweist, eine elektrische Schalttafel blinkt, der Rest ist mit kohlenstaub bedeckter Sperrmüll. So sieht kein Pult eines Dirigenten aus.
In einer neueren Halle aus der Vorwendezeit stoßen wir auf technisches Inventar, das sich erfolgreich gegen jeden Investitionswillen hat behaupten können. Und wir stoßen auf Menschen. Eine resolute Frau mittleren Alters, die sich nicht schon wieder fotografieren lassen will, formt mit ihren Händen und Holzschablonen speziell gefertigte Ziegel, die sich der Standardproduktion entziehen. Sie gibt bereitwillig und freundlich Auskunft über ihr Tun und wirft dabei die Lehmstücke, die über den Rand der Schablone treten und von ihr abgeschnitten werden auf einen sich grotesk auftürmenden Berg. In die noch formbare weiche Masse drückt sie auf jeden Ziegel einen Stempel. Der Stückpreis eines solchen Ziegels kann leicht die 10 Euro-Marke überschreiten, sagt sie im stolzen Bewusstsein ihrer handwerklichen Fertigkeit. Weiter hinten in der Halle geht es wesentlich weniger filigran zu. Ein Trupp von sechs an Gesicht, Händen und Kleidung lehmverschmierter Männer macht deutlich, dass trotz einiger Technisierung die Herstellung von Ziegeln immer noch zum großen Teil aus schwerer Handarbeit besteht. Unentwegt schafft ein Förderband große Lehmklumpen herbei. Die »Batzen« werden mit erheblicher körperlicher Kraft in eine Holzform geschlagen und nachgedrückt, die überstehenden Ränder mit einem Draht abgestrichen und die so geformten Ziegel aus der Form herausgelöst. Als Trennmittel dient Wasser und Sand. Das verleiht den Handstrichziegeln ihre spezielle Oberflächenstruktur. Der Umgangston unter den Männern und mit dem neugierigen Frager ist so rauh wie die Struktur ihrer gebrannten Ziegel. An der Wand hängt eine Tafel, auf der mit Kreidestrichen das Soll und Haben ihrer Arbeitsleistung des Tages vermerkt ist.
Der heutige Besitzer und Geschäftsführer, Harald Dieckmann, der eigentlich ein Architekt aus Süddeutschland ist, hat die Ziegelei 2004 übernommen. Mit überschrittenen fünfzig Jahren und leichtem Bauchansatz fehlt diesem großen und ruhigen Mann gänzlich das Auftreten der einstigen, von Theodor Fontane beschrieben Ziegellords. In seinem schmucklosen Büro waltet er mit fast körperlich spürbarer Gelassenheit und man glaubt ihm sofort, wenn er die Führung dieser Ziegelei mit ihren 25 Mitarbeitern eher als eine persönliche Leidenschaft für Mensch und formbares Material begreift, denn als sich schnell amortisierende Kapitalinvestition. Dass versichert mir auch der Betriebsleiter, Herr Klünder, der sich hier im Brandenburgischen seinen rheinischen Dialekt nicht hat nehmen lassen. Ohne die in homeöpatischen Dosen gereichten regionalen Investionshilfen sei ein solcher Betrieb nicht zu führen. Er sei der technisch, Herr Dieckmann der künstlerisch Ambitionierte, den bei der Investition erheblicher Eigenmittel doch vor allem die kreativ gestalterischen Möglichkeiten der Ziegelproduktion interessiere.
Dass der Standort der Ziegelei behutsam für den Tourismus entwickelt wird, sieht man am Vorhandensein eines Ziegeleimuseums, das in einem sorgfältig restaurierten Ziegeleiturm unterbracht ist und an einem vorgelagerten Gebäude mit Blick auf den Glindower See, in dem Beispiele der aktuellen Ziegeleiproduktion präsentiert werden.
Und was hat es abschließend mit der Alpenstraße auf sich, über die man die Ziegelei Richtung Werder wieder verläßt? In unmittelbarer Nähe zum Ziegeleigelände liegen die sogenannten Glindower Alpen, eine zum Naturschutzgebiet erklärte Abraumhalde, deren teilweise 40 Meter tiefen Schluchten mit Mischwäldern aus Berg- und Spitzahorn, Hainbuche, Winterlinde, Esche, Rotbuche und Robinie bewachsen sind. Totholz wird nicht beräumt und ist von Moosen und Flechten überwuchert. Ein Besuch lohnt. Pädagogische Belehrung darf natürlich nicht fehlen.
Unsere Zeitreise endet profan: An einer zur Wurstbude umgebauten Tankstelle auf dem Weg durch Werder mit Thüringer, Schrippe, Senf und Kaltgetränk. Davon werden die Ziegler der Gründerzeit bei ihrem Tun in der täglichen Gluthitze allenfalls haben träumen können. Auch wenn sie es waren, die mit ihrer täglichen Hände Arbeit die Voraussetzung zur Entstehung der Metropole Berlin geschaffen haben. Hier dürfen wir uns wieder einmal mehr mit Goethe trösten: »Die jetzige Generation entdeckt immer, was die alte schon vergessen hat.« Das wird hoffentlich noch eine Weile so bleiben.
Manfred Carpentier, 2015
EDITION CARPENTIER